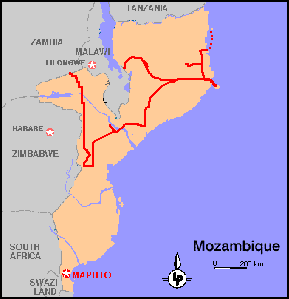Moçambique
|
|
|
"Das, was Du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was Du sagst."
(Sprichwort aus Moçambique)
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
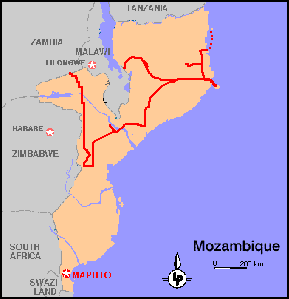
|
|
|
Datum:
|
31. Mai 2008 bis 22. Juni 2008
|
|
Strecke:
|
3'938 km
|
|
Diesel:
|
36,96 Meticais/Liter (Nampula)
|
|
Währung:
|
1 Metical = 100 Centavos; 1 US-$ = 24,10 Meticais
|
|
Visum:
|
US-$ 30; an der Grenze ausgestellt
|
|
Route:
|
Cassacatize (Grenze zu Sambia) - Tete - Chimoio - Sussundenga - Dombe - Sambanhe - Inchope - Caia - Vila de Sena - Caia - Mocuba - Alto Molocue - Nampula - Ilha da Moçambique - Nacala - Namialo - Namapa - Metoro - Pemba - Medjumbe Island - Pemba - Metoro - Alua - Muhula - Alua - Namialo - Nampula - Cuamba - Mandimba (Grenze zu Malawi)
|
| Klima: |
Temperaturen:
Sonnentage:
Regentage:
Durchzogene Tage:
|
Ø 15 ° C  bis 28 Ø ° C bis 28 Ø ° C 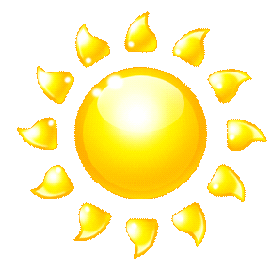
11
3
8
|
|
|
|
Fotoalbum
|
|
|
|
Tagebuch
31. Mai 2008
…ob wir
bereits ein Visum hätten. Auf unsere abschlägige Antwort hin meint er, er könne
uns nach Ausfüllen der Formulare innert 10 Minuten ein Visum ausstellen. Während
wir auf die Ausstellung der Visa warten, fordert uns der Zöllner auf, ihm unser
Auto und dessen Inhalt zu zeigen. Leider blieb es nicht beim Türeöffnen – nein,
er möchte sogar in unsere Kühlbox sehen. Als er unsere sechs Liter Milch und
einige weitere Nahrungsmittel sieht, gibt er sich vorerst zufrieden. Alsdann
möchte er aber zusätzlich in unsere grösste Schachtel sehen. Wir erklären ihm,
was sich darin befindet, und damit ist die Durchsuchung fast abgeschlossen.
Aber eben nur fast: er entdeckt unsere Feldstecher und fragt, was der Zweck
dieser Gegenstände sei. Wir erklären ihm, dass man damit Dinge in weiter Ferne
sehen kann, und er nimmt daraufhin wohl zum ersten Mal einen Feldstecher in die
Hand und lacht erfreut, als er Dinge erkennen kann. Kurz darauf erhalten wir
tatsächlich unsere Pässe zurück mit Visum und Sticker – zwar nicht innert 10,
sondern innert 30 Minuten. Nach dem Zeigen unserer
Haftpflichtversicherungsunterlagen (in Kopie) und einem ausgiebigen Gespräch
mit dem Immigration Officer über dessen Arbeitssituation, seinem Verdienst und
seiner Familie haben wir nach knapp eineinhalb Stunden die sambische und
moçambikanische Grenze überschritten. Zum wiederholten Male hat sich unser
Sambia-Reiseführer als fehlerhaft herausgestellt, und uns wird klar, dass nur
selbst gemachte Erfahrungen ernst zu nehmen sind. Wir sind froh, dass sich die
Grenzbeamten bisher mit einer Kopie der Haftpflichtversicherungspolice
zufrieden gegeben haben – das Original haben wir nämlich so gut versteckt, dass
wir es selber nicht mehr finden können...
Stundenlang
fahren wir in Richtung Tete und treffen unterwegs praktisch keine Autos an. Die
Behausungen der Menschen ähneln jenen in Sambia sehr stark. Es geht durch
hügeliges Gelände und durch eine einsame Berglandschaft mit nur wenigen Dörfern.


Wie wir einmal anhalten, um zwei Männer zu fotografieren, die eine schwere Last auf dem Kopf tragen, schart sich sofort eine grosse Menschenmenge um uns. Alle wollen unbedingt auch fotografiert werden - und schon haben wir das erste moçambikanische Gruppenfoto, und es sind so viele Leute, dass gar nicht alle auf das
Foto passen! Wir sind
völlig überrascht, dass die Leute von uns fotografiert werden wollen.
Als Schlafplatz wählen wir einen Hügel, welchen wir über eine sehr steile und steinige Piste erreichen.



1. Juni
2008
Um elf Uhr
erreichen wir die geschichtsträchtige Provinzhauptstadt Tete, welche seit Jahrhunderten
mit der 750 m langen Sambesi-Hängebrücke eine strategische Bedeutung als
Kreuzung grosser Handelsstrassen geniesst. Der Brückenzoll beträgt 20 Meticais.
Da heute Sonntag ist und die Geschäfte geschlossen haben, reduzieren wir uns
auf Geldbezüge und Auftanken. Bereits vor der Stadt und vor allem nach der
Stadt säumen unzählige Baobabs die Strasse – Tete liegt nämlich in einer
einmaligen Baobab-Ebene und wird zu Recht „Provinz der Baobabs“ genannt.
Während rund 100 km reihen sich knorrige Baobabs und traditionelle
Rundhütten-Dörfer aneinander. Die Natur entschädigt uns für die nervige, von
Schlaglöchern durchsetzte Teerstrasse, die sich an die Baobab-Ebene
anschliesst. Leider geht die Fahrt nur sehr langsam voran, da Helen am liebsten
jeden Baobab fotografieren möchte.



Als wir vor
einem doppelstöckigen Brunnen für ein paar Fotos anhalten, werden wir von einer
grossen Menschenmenge umringt. Von einer alten Frau erhalten wir zwei
Baobab-Früchte in die Hand gedrückt, und ein Junge erklärt uns, wie wir den
Inhalt essen können: Man schlägt die Frucht solange auf einen Stein, bis sie
zerbricht. Den weissen nahrhaften Inhalt kann man dann roh essen. Diese Baobab-Früchte werden entlang der Strecke immer wieder feilgeboten.




Unterwegs
treffen wir eine Ziege an. Allerdings nicht am Boden, sondern auf der Ladung
eines Lkws. Tiere haben in Moçambique (und wohl auch im restlichen Afrika) einen
ganz anderen Stellenwert als bei uns in Europa… A propos Ladung: Die Ladung eines Pkws kann ohne weiteres doppelt so hoch sein wie das Auto selbst, und wenn es noch mehr Gepäck zu transportieren gibt, wird einfach noch ein Anhänger gezogen!



Heute sehen wir, wie die überall in Sambia und Moçambique in grossen weissen Säcken am Strassenrand verkaufte Holzkohle hergestellt wird. Die Köhler graben eine längliche Grube mit zwei Belüftungsöffnungen, füllen sie mit Holz, zünden dieses an und bedecken die Grube anschliessend mit sandiger Erde. Nach einer gewissen Zeit graben sie kleine Stollen, um zu prüfen, ob die Holzkohle bereits fertig ist. Wenn ja, wird der "Deckel" abgetragen, und die Holzkohle kann verkauft werden. Da der "Deckel" und die umliegende Erde sehr heiss wird, kommt es vor, dass die Gräser und Sträucher (und manchmal sogar Bäume) in der Umgebung abbrennen oder verkohlen.



Auf der Weiterfahrt in Richtung Catandica wird in den Dörfern gefestet. Überall stehen
Menschen auf der Strasse, es wird gegessen, getrunken, geredet und gelacht –
ein afrikanisches Fest für alle Sinne. Da es langsam eindunkelt, beeilen wir
uns umso mehr, den gewünschten Schlafplatz (Pink Papaya Forest Retreat),
welcher 6 km südöstlich von Catandica liegen sollte, zu erreichen. Dort
angekommen, erwarten uns leider nur verlassene Ruinen. Leider erweist sich auch
der Reiseführer von Moçambique als fehlerhaft. Bald wird es dunkel, und wir
wissen nicht, wo wir unser Nachtlager aufschlagen sollen. Uns überkommt die
Idee, bei der umzäunten Sonnenblumenölfabrik zu übernachten, was der Wächter
aber leider nicht zulässt. Uns bleibt deshalb nichts anderes übrig, als in den
Dunkelheit nach Chimoio zu fahren. Unterwegs sehen wir in allen Dörfern riesige
Festfeuer (leider äussert sich unser Reiseführer nicht zu diesem Festtag). Zu
den üblichen Gefahren einer Fahrt durch die Nacht (unbeleuchtete Fahrzeuge,
Ochsenkarren, Fahrradfahrer, Fussgänger und Tiere) kommt heute die Gefahr durch
Betrunkene hinzu, die unkontrolliert den Strassenrand entlang torkeln. Weil
heute unser Glückstag ist, wird die Teerstrasse durch eine ca. 40 km lange
Umleitung unterbrochen.
In Chimoio
angelangt steuern wir durch die nervenaufreibende Fahrt total verschwitzt
direkt ins Hotel Executivo Manico.
2. Juni
2008
Die Zeiten
der üppigen Morgenessen sind vorbei – wir müssen sogar um ein paar Scheiben
Toast kämpfen. Den Kampf um etwas Butter und Konfitüre geben wir auf. Ach ja,
wir kämpfen übrigens nicht gegen andere Gäste, sondern gegen die unbeschreibliche
Faulheit des Kellners…
Nach den
paar mickrigen Happen kreischt Helen los. Und zwar lange und laut. Der Grund
war nicht etwa eine Anophelesmücke, die sich an ihre zarte Haut wagte, sondern
der Dreck vom Santi. Besser gesagt, der nicht mehr vorhandene Dreck. Der
Nachtwächter hat nämlich unser Auto geputzt, und jetzt haben wir einen
glänzenden weissen Santi. Mist, Riesenmist und Doppelmist! Wir waren so stolz
auf unseren Dreck von den bisher bereisten Ländern, und jetzt ist alles weg!
Der Nachtwächter kann nicht verstehen, weshalb wir seine Arbeit gering schätzen.
Noch lange auf dem Weg in Richtung Dombe trauern wir dem Dreck nach, doch der
Dreck, der ist weg.
Da wir
beide der portugiesischen Sprache (= Landessprache in Moçambique) nicht mächtig
sind, versuchen wir im „Posto da Zimbe“ Briefmarken zu kaufen. Erst mit der
Zeit verstehen wir dank des einige Brocken Englisch sprechenden Lehrers einer
nahe gelegenen Schule, dass es sich hier nicht um eine Poststelle, sondern um
die Stadtverwaltung handelt… Der Weg nach Dombe ist zumindest zu Beginn eintönig. Erst mit der Zeit schlängelt sich
die Piste durch hügeliges Gelände, die Bäume werden grösser, und am Schluss
kommen wir uns neben den sich in den Himmel drängenden gigantischen Urwaldriesen
so richtig mickrig klein vor. Den Nachmittag verbringen wir auf einer steinigen
Wiese und geniessen Sonne und Ruhe.




3. Juni
2008
Weiter geht
die Fahrt durch hügelige Waldlandschaften, die durch etliche Bananenplantagen
unterbrochen werden. Auch auf der nachfolgenden Ebene reiht sich Bananenplantage an Bananenplantage. Da auf der Erdpiste die Toyota-Sammeltaxis nicht mehr weiterkommen würden, werden hier Toyota-Lieferwagen als Sammeltaxis genutzt. Auf der Ladefläche drängen sich alsdann eine Unzahl von Personen mit ihrem ganzen Gepäck und lassen sich über die holprige Piste rumpeln.



Kurz vor Dombe quert ein Fluss unseren Weg. Früher gab es eine Brücke über den Fluss, doch heute stehen nur noch zwei
Brückenpfeiler im Wasser – die Brücke ist eingestürzt. Da der Santi noch nicht
schwimmen kann, kehren wir um und treffen kurz darauf in Dombe auf eine
handbetriebene Fähre über den Rio Lucite. Wenn wir die Fähre benutzen würden, könnten wir nach
Zimbabwe reisen. Doch wir möchten noch etwas in Moçambique verweilen, sitzen
ans Ufer des im Dorfleben von Dombe eine wichtige Rolle spielenden Rio Lucite und beobachten
eine Zeit lang die Fähre und die im schmutzigen Wasser des Rio Lucite ihre Wäsche
waschenden Frauen. Neben der grossen Fähre, welche Autos und Menschen
transportiert, gibt es noch flache Boote, die Fussgänger vom einen ans andere
Ufer übersetzen. Diese Boote sind in ihrer Art einzigartig, denn sie bestehen
nur aus der Rinde eines einzigen Baumes und bieten neben dem Fährmann noch zwei
bis drei Personen Platz. Der Fährmann stakt das Kanu mit einem langen Stock
gemütlich über den Fluss. Nach unserem Reiseführer soll diese traditionelle
Bootsbauart heute sonst nirgends mehr zu finden sein, und im naturhistorischen
Museum von Maputo wird ein solches Boot ausgestellt.





Wir
verlassen Dombe auf einer breiten, gut ausgebauten Piste und fahren nach
Erreichen der Teerstrasse (EN1) bis kurz nach Inchope zum Complexo Arco Iris,
eine offenbar empfehlenswerte Unterkunft. Diesen Hinweis unseres Reiseführers
können wir nicht bestätigen, denn während der Nacht versuchen Leute, den Santi
von seiner Dachlast zu befreien, derweil sich der stockbesoffene Wächter ein
Nickerchen gönnt. Markus erwacht rechtzeitig, bewaffnet sich mit der
Magnum-Stablampe, zieht die Kampfstiefel an und macht sich zur Verteidigung
bereit. Per Zufall erwacht jetzt auch Helen und wundert sich, wo Markus ist.
Plötzlich sieht sie ihn vor der Hecktüre kauern und erkundigt sich, was los
sei. Markus schildert ihr die Lage und steigt alsdann aus, um die Diebe zu
verjagen. Diese haben sich jedoch zurückgezogen und besprechen wohl ihre
nächsten Diebstahlversuche, denn wir hören immer wieder Menschen reden, aber
zum Glück bleiben wir von weiteren Diebstahlversuchen verschont. Nach einiger
Zeit des gemeinsamen Wachens versuchen wir noch etwas zu schlafen, was aber
beiden nicht gelingt.
4. Juni
2008
Wir fahren
deshalb bereits um viertel vor sechs Uhr los und erreichen um die Mittagszeit in
Vila de Sena die ehemals längste Eisenbahnbrücke der Welt (Länge: 3'660 m). Wegen
der hohen Sterberate während des Brückenbaus wurde die Brücke auch „Brücke der
zum Tod Verurteilten“ genannt und 1983 von der RENAMO (Unabhängigkeitskämpfer)
gesprengt. Seit ein paar Jahren wird sie wieder instand gestellt. Wir erleben
gerade mit, wie der indische Bauführer ein paar einheimische Arbeiter
zurechtweist, die offenbar nicht bzw. nicht genügend rasch gearbeitet haben. Wir
sind derart überwältigt von den Ausmassen der Brücke, dass wir den Bauführer um eine
Fotoerlaubnis bitten, die er uns gerne erteilt. Gemäss seinen Aussagen sind die
Ausführungen in unserem Reiseführer, wonach man gratis oder gegen ein Entgelt
mit dem Auto über die Brücke fahren könne, falsch – man kann nämlich seit
vielen Jahren nicht mehr darüber fahren.



Auf der
Rückfahrt nach Caia erblicken wir die Überreste der Brücke nach Mutarara und
erfahren von dort anwesenden Kindern, dass die Brücke vor zwei Monaten von den
Fluten des Sambesi fortgespült wurde. Das Unwetter hat mitten in der Nacht
riesige Landstriche überflutet und ganze Dörfer zerstört. Es gab sogar Tote.
Wir sind über diese Naturkatastrophe sehr entsetzt, können aber leider nichts
anderes tun, als den Kindern eine kleine Freude zu bereiten, indem wir ihnen
Luftballone schenken.



Kurz darauf
halten wir neben einer „Ziegelfabrik“. Hier stellen rund 50 Personen Lehmziegel
her. Der anwesende „Manager“ erklärt uns, dass die Ziegel aus Wasser, Sand und
Erde hergestellt werden. Mit blossen Händen werden die Ziegelformen mit dem
Matsch gefüllt. Danach trocknen die Ziegel während dreier Tage an der Sonne und
werden dann zu einem grossen Haufen (einer Art Backofen) aufgeschichtet. Dieser
Haufen bzw. Backofen wird nachher mit Lehm „versiegelt“ und mit Feuer
aufgeheizt. Die so entstehende Hitze brennt die Ziegel rund einen Tag lang.
Jetzt sind die Ziegel wasserfest und stabil und können für den Hausbau
gebraucht werden. Erst durch das Brennen werden die Ziegel stabil und
wasserfest. Pro Tag kann ein Arbeiter bis zu 400 Ziegel herstellen. Diese
„Ziegelfabrik“ wird von der moçambikanischen Regierung gesponsert und
ermöglicht den Flutopfern, die Ziegel für ihre neuen Häuser selber und
kostengünstig herzustellen. Wir sind erstaunt, mit was für einfachen
Utensilien es möglich ist, „Backsteine“ zu produzieren.





Nach Caia
zurückgekehrt, biegen wir ein auf eine gute Teerstrasse, welche uns kurz darauf
zum gemächlich dahin fliessenden Sambesi führt. Hier wird an einer 2,5 km
langen Brücke gearbeitet. Bis zu deren Fertigstellung wird der gesamte Verkehr
mittels einer einzigen langsamen und altersschwachen Motorfähre abgefertigt.
Schon von weitem ist eine lange Lkw-Schlange zu sehen, die wir allesamt links
stehen lassen. Wir ergattern uns einen guten Warteplatz. Während der Wartezeit
klopfen vergebens mehrere Verkäufer an die Autoscheiben und anerbieten die
verschiedensten Waren und Dienstleistungen. Die Überfahrt muss Helen ausserhalb
des Fahrzeugs verbringen, da nur der Fahrer im Auto sitzen bleiben darf. Wir
sehen, wie der hintere Teil der Fähre unter Wasser ist und Wasser in die Fähre
hineinläuft. Die Regel, dass nur der Fahrer im Fahrzeug sitzen darf, liegt wohl
darin begründet, dass im Fall des Versinkens der Fähre nicht allzu viele
Personen im Fahrzeug eingeschlossen sind!

Heil am
Ufer angekommen, machen wir uns auf den Weg nach Quelimane, um später die endlosen Kokospalmenpantagen zu besichtigen. Die Asphaltstrasse
erlaubt bis zum Eindunkeln eine zügige Fahrt. Im Dunkeln werden wir von einem
weissen Lieferwagen mit übersetzter Geschwindigkeit überholt, auf dessen
Ladefläche zwei Männer sitzen. Kurz darauf bemerken wir, wie er am Strassenrand
anhält. Gleichzeitig erblickt Markus etwas Komisches in unserem Scheinwerferkegel und
bremst abrupt ab. Wir sehen einen Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad am Boden
liegen, und wie Blut in den Strassengraben fliesst. Ganz offensichtlich hat der
Lieferwagen den Fahrradfahrer überfahren. In der Annahme, die Männer des Lieferwagens
würden dem Fahrradfahrer helfen, fahren wir weiter. Der Lieferwagen setzt sich
jedoch sofort wieder in Bewegung und fährt mit minimem Abstand hinter uns her.
Nach einiger Zeit überholt er uns. Schockiert über dessen Verhalten diskutieren
wir, was zu tun sei, und ob wir umkehren sollen. Wenige Minuten später werden
wir von zwei weiteren Autos überholt, und der eine bedeutet uns, dass wir
anhalten sollen. Uns ist mittlerweile klar geworden, dass der Lieferwagen
einerseits hoffte, wir würden den Fahrradfahren auch überfahren, und dass er
versuchen wird, uns die Schuld am Unfall in die Schuhe zu schieben. Wir halten
deshalb nicht an, sondern fahren weiter bis zum Abzweig nach Quelimane. Wir
halten an und erzählen den dort anwesenden Polizisten, was passiert ist.
Während er unseren Bericht entgegennimmt, fährt doch tatsächlich der
unfallverursachende Lieferwagen vorbei. Der Polizist versucht, seine Kollegin
am Dorfende zu erreichen, damit diese den Lieferwagen aufhalte. Doch diese
erscheint kurz darauf auf dem Sozius eines zivilen Motorrades sitzend an
der Kreuzung. Der Fahrer des Lieferwagens weiss jetzt, dass wir ihn „verpetzt“
haben, und wir befürchten, dass er uns deswegen etwas antun könnte. Auf den
Schutz der ineffizienten und unerfahrenen Polizei möchten wir uns nicht
verlassen müssen, und fahren deshalb in entgegengesetzter Richtung durch die
Nacht bis kurz nach Nipiodi. Bei der Polizeikontrolle in Alto Molocue salutiert der
Polizist und winkt uns ohne jegliche Kontrolle durch. Ausnahmsweise sind wir
froh, dass unser Reiseführer mangelhaft recherchiert ist, denn statt der
angekündigten schlechten Schotterpiste mit vielen Schlaglöchern fahren wir auf einer sehr gut ausgebauten
Teerstrasse.
Heute haben
wir während gut 15 Stunden Fahrt insgesamt 740 km zurückgelegt, und trotz
dieser Strapaze können wir kaum schlafen und schrecken beim kleinsten Geräusch
hoch – immer in der Angst, der Lieferwagenfahrer habe uns aufgespürt.
5. Juni
2008
Nach nur
wenigen Stunden Schlaf setzen wir unsere Flucht bzw. unsere Reise nordwärts
fort. Da in Moçambique die Schulen oft bereits um sechs Uhr beginnen, treffen wir kurz nach unserer Abfahrt auf viele Schüler, die zu Fuss oder mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Mit der Zeit fühlen wir uns etwas sicherer, halten vermehrt für Fotos an
und verwerfen unseren Plan, nach Pemba durchzufahren. Stattdessen definieren
wir Nampula als Tagesziel. Unterwegs fahren wir immer wieder an kleinen
Verkaufsständen vorbei, die allerlei Früchte feilbieten. Da wir Lust auf etwas
Vitamine verspüren, kaufen wir eine Staude „richtiger“ Bananen (60 Bananen
für 20 Meticais) und eine riesengrosse Papaya. Die grösste Papaya, die wir
bisher gesehen haben, war übrigens kleiner als die kleinste Papaya, die hier
zum Verkauf angeboten wird!





Trotz der
Dunkelheit gelingt es uns in Nampula erstaunlich rasch, das „Executive Hotel“ zu finden. Lange werweissen wir hin und her, ob wir in diesem Hotel übernachten
sollen. Der Grund unseres Zögerns liegt darin, dass der nicht umzäunte
Hotelparkplatz direkt an der Strasse liegt. Wir gehen sogar an die Reception
und fragen, ob der Parkplatz sicher ist. Als der Receptionist uns mehrmals
versichert, die zwei Wächter würden den Wagen gut bewachen und es werde
garantiert nichts passieren, nehmen wir das Pyjama aus dem Wagen und
verschwinden in unserem Hotelzimmer. Wir sind sehr froh und erleichtert, dass
der Tag ohne die befürchtete Konfrontation mit dem Lieferwagenfahrer verlaufen
ist!
6. und 7.
Juni 2008
Nach dem
Erwachen besuchen wir als erstes unseren Santi. Da er immer noch „ganz“ ist und
wir keine Lust zur Weiterfahrt haben, entscheiden wir uns, es sei für uns sicherer,
im Hotel zu bleiben.
Wir füllen
deshalb unsere Lebensmittelvorräte auf und machen eine Stadtbesichtigung. Wobei
„Besichtigung“ fast zuviel gesagt ist; es ist eine gesichtslose Stadt ohne
Sehenswürdigkeiten. Wenigstens finden wir eine Glassicherung, so dass wir
zumindest den 220-V-Konverter wieder ohne überbrückende Flugsicherung betreiben
können.
Im Hand-und-Fuss-Gespräch mit den Parkplatzwächtern stellt sich heraus, dass diese während 48 Stunden
nonstop arbeiten müssen, und dann 48 Stunden Freizeit haben. Für uns ist es
fast unvorstellbar, so lange wach zu sein – insbesondere deshalb, weil Schichtanfang
und –ende jeweils morgens um 4 Uhr ist… Als Dank, dass die beiden Wächter so
gut auf unseren Santi aufpassen und uns sogar einen speziellen Parkplatz
zugestanden haben, schenken wir ihnen allen eine Tafel Schweizer Schokolade.
Die Freude über das unerwartete Geschenk ist riesig!
Noch ein
Wort zum Personal: Zum Teil bemühen sich die Angestellten intensiv um das Wohl
der Gäste, und zum Teil ist es ihnen absolut egal. So hat ein Kellner zum
Beispiel überhaupt keine Hemmungen, eine Flasche Mineralwasser mit
Leitungswasser aufzufüllen, und die Verkäuferin vom Souvenirshop schliesst den
Laden einfach, um etwas früher heimzugehen. Auf der anderen Seite gibt es sehr
aufmerksame Kellner und einen Hotelmanager, der sogar in seiner Freizeit alles
daran setzt, unsere Wünsche zu erfüllen.
Das
„Executive Hotel“ ist zwar ein 4-Sterne-Hotel, bleibt aber den Tücken der
moçambikanischen Infrastruktur ausgeliefert. Mit anderen Worten: Wenn das
Quartier kein Strom oder kein Wasser hat, so gilt dies auch für das Hotel. Nicht
besonders angenehm, wenn man am Abend – wie Helen – eingeseift unter der Dusche
steht und das Wasser erst wieder am anderen Morgen fliesst…
8. Juni
2008
Nach einem
kalten Frühstück (kein Strom) und ohne zu duschen (kein Wasser) brechen wir
frühmorgens auf, um die Ilha de Moçambique zu besuchen. Vorher haben wir die
Hotelrechnung selbst geschrieben (die Dame an der Reception ist dazu selbst
nicht in der Lage) und – da wir nicht mehr genügend Meticais haben und mangels
Strom nicht mit der VISA-Karte bezahlen können – in US-$ beglichen. Zum Glück
gibt es in anderen Stadtquartieren Strom, und so können wir von einem
Geldautomaten Geld beziehen und den letzten Dieseltank auffüllen.
Bevor wir zur 2,5 km langen Brücke vom Festland zur Insel (Brückenzoll 10 Meticais) gelangen, durchqueren wir einen herrlichen Palmenhain.


Die kleine
Insel „Ilha de Moçambique“ soll die Geschichte im südlichen Afrika mehr
beeinflusst haben als irgendein anderer Ort dieses Kontinents. Die von der UNO
zum Weltkulturerbe erklärte Insel ist leider dem Verfall preisgegeben. Die
Bewohner krümmen nicht den kleinsten Finger, um die geschichtsträchtige Insel
zu unterhalten. Lediglich einige wenige Bauten wurden aufwändig renoviert und
zum Teil zu Museen umgestaltet. Wir fahren kreuz und quer durch die Insel, bis
wir beim Eingangsportal des alten Zollhauses (Capetania) auf zwei Kanonen und
einen 3 m hohen Anker treffen. Sofort wird er von uns in Beschlag genommen,
aber leider können wir ihn nicht mitnehmen, da er etwas zu schwer ist. Als Ersatz machen wir dafür einige witzige Fotos.


Anschliessend fahren wir bis zum Fort (Fortaleza da Sebastiao). Bei der Ankunft werden wir von zahlreichen
Kindern und Jugendlichen „überfallen“. Nicht dass sie uns bestehlen wollen,
nein, es kämpft vielmehr jeder darum, unser Auto für etwas Geld bewachen zu
dürfen. Sie schlagen sich zum Teil sogar mit Stöcken. Dem Ältesten übergeben
wir nach dem Verhandeln des Preises das Auto in Gewahrsam und betreten an der
Westseite den Eingang zum Fort. Vom versierten Guide erfahren wir mancherlei
interessante Details aus der Geschichte des Forts und der Insel. Die zwischen
1558 und 1620 erbaute Fortanlage präsentiert sich in einem vergleichsweise
guten Zustand. So funktioniert zum Beispiel noch die gesamte Wasseranlage. Auf
den Dächern wird nämlich das Regenwasser aufgefangen und mittels eines
ausgeklügelten Systems in einer riesigen Zisterne gespeichert. Da die Zisterne
seit deren Erstellung nie austrocknete, ist das Wasser darin zum Teil mehrere
hundert Jahre alt. Zum Trinken ist es deshalb ungeeignet, aber noch heute wird
es von den Bewohnern zum Wäsche waschen gebraucht. Uns beeindrucken auch die
unzähligen Kanonen auf den Dächern, welche teilweise immer noch auf den
Gestellen platziert sind. Der Exekutionsplatz und die Geschichte der zum Tod
verurteilten Gefangenen hinterlässt ein etwas mulmiges Gefühl.


Am meisten beeindruckt
hat uns die am nördlichsten Ende der Insel gelegene Kapelle (Capela de Nossa
Senhora de Baluarte). Sie wurde anno 1521/22 gebaut und gilt damit tatsächlich
als das älteste europäische Gebäude der gesamten südlichen Hemisphäre. Sie ist
zwar recht bescheiden, wirkt jedoch mit ihrer Vorhalle, den Rundbögen, Zinnen und
Grabplatten trotzdem speziell.

Der
riesige, rot angestrichene Gouverneurspalast (Palácio de Sao Paulo) mit
integrierter St. Pauls Kapelle fällt uns sofort auf. Bis 1898 sollen hier
portugiesische Gouverneure residiert haben. Wir lassen uns die Räumlichkeiten
von einem anderen, ebenfalls sehr kompetenten Führer zeigen bzw. erklären. Er
weiss sehr viel über die Geschichte der Insel und der ausgestellten Gegenstände
zu berichten, und es macht Freude, mit über die Sandalen angezogenen
Kunststoffüberziehern durch die Räume zu wandeln. Im Erdgeschoss besuchen wir
das maritime Museum, welches u.a. einige alte Schiffsmodelle und –bestandteile
ausstellt (so auch das Beiboot von Vasco da Gama). Zwei ausgestellte Kanonen
identifiziert Markus als von den Deutschen im 1. Weltkrieg benutzte Waffen –
was deren Standort in einem maritimen Museum etwas fragwürdig erscheinen lässt.


Die
Insulaner nutzen die Zeit der Ebbe, um im flachen Wasser Muscheln, Krabben oder
farbige Steine (für die Schmuckherstellung) zu suchen. Das Meer bzw. der schlammige Sandstrand stinkt aber gewaltig, und uns käme es uns nie in den Sinn, hier auf der Insel Fische oder Krustentiere zu essen. Irgendwie
sind wir sogar froh, am Nachmittag der Insel den Rücken zukehren zu können. Das
Wetter schlägt um, und auf der Fahrt nach Niacala ziehen dunkle Regenwolken
auf. Den Regen hätten wir nun sicher nicht mehr gebraucht. Rund eine Stunde nach einem wunderschönen Sonnenuntergang erreichen wir den Campingplatz Bay Diving & Camping.

9. Juni 2008
Beim Aufstehen realisieren wir, wie schön der Campingplatz
gelegen ist: Inmitten vieler Bäume und Palmen thront er mit Aussicht aufs Meer
mitten in der Natur. Zwar ist es immer noch sehr windig und bewölkt, aber
nichts desto trotz machen wir einen langen Spaziergang am Meer. Die Wellen sind aber zu gross, als dass Schnorcheln möglich bzw. sinnvoll wäre, und so verbringen
wir den Rest des Tages mit dem Streicheln des Campingplatz-Hausschweines und gewissen organisatorischen Belangen…



10. Juni 2008
Eine lange Fahrt steht uns bevor, da es heute entlang von riesigen
Cashew-Nuss-Plantagen, Baumwollfeldern und weiteren Plantagen nach Pemba geht.
Wir sind heute etwas im Zeitdruck und kochen deshalb zum Mittagessen neben dem Auto zwar
Teigwaren, essen sie aber unterwegs während dem Fahren.
Die Menschen sind etwas zurückhaltender als im südlichen
Teil von Moçambique, aber sobald wir anhalten, um ein paar Fotos zu machen,
überwinden sie ihre Scheu, rennen herbei und wollen unbedingt auch fotografiert
werden.
Kurz vor Pemba werden wir von zwei Polizisten herausgewunken
– sie sind offensichtlich auf der Suche nach etwas Geld. Aber da unsere
Dokumente allesamt in Ordnung und wir sehr geduldig sind, haben sie Pech. Dafür
erreichen wir Pemba erst kurz nach Einbruch der Dunkelheit… Die Nacht
verbringen wir im „Pemba Beach Hotel & Spa“ und sichern den Santi auf dem
hoteleigenen, bewachten Parkplatz mit Lenkradschloss und „Hiltis-Spezial-Diebstahlsicherung“. Warum?
Ganz einfach: Morgen geht es mit grosser Freude per Propellerflugzeug für ein paar Tage nach Medjumbe Island.
11. bis 16. Juni 2008
Wir erholen uns auf der eine knappe Flugstunde nördlich von Pemba gelegenen Trauminsel „Ilha de Medjumbe“ und
lassen es uns gut gehen. Wir haben schon viele Inseln gesehen, aber noch nie eine so
traumhaft kleine und schöne – wir kommen uns in jeglicher Hinsicht vor wie im Paradies! Ein wunderschöner
weisser Sandstrand umgibt die 850 m lange, 350 m breite und von Korallenriffen umgebene Insel,
und nur gerade 13 Chalets stehen den Gästen zur Verfügung.
Während wir jeden Tag dem Strand entlang spazieren und dabei Unmengen von Muscheln finden bzw. zum Teil aus dem Sand ausgraben und uns dabei wie Schatzsucher vorkommen, vergnügt sich unser Panther mit dem Bauen von Sandburgen und dem Bewachen unserer Muschelschätze. Das Baden im kristallklaren und warmen Meer ist
auch schön, nur das Schnorcheln ist wegen dem starken Wind und dem daraus
resultierenden Wellengang nicht besonders faszinierend. Dafür lassen wir uns im
privaten Whirlpool und im Restaurant verwöhnen!
Obwohl wir noch nie an einem so schönen Ort waren, beginnen
wir uns nach ein paar Tagen auf die Weiterfahrt zu freuen – schliesslich lebt
es sich auch im Santi hervorragend!








Nach unserem letzten Frühstück auf der wunderbaren Insel
fliegen wir aufgrund der Schlechtwetterfront mit einer Stunde Verspätung nach Pemba ins Pemba Beach Hotel & Spa. Im Hotel angekommen, machen wir uns wieder an die Arbeit. Es heisst, die unzähligen gefundenen Muscheln zu verstauen, und wir fragen uns, wo diese zum Teil riesigen Muscheln Platz finden und
die Reise unbeschadet überleben sollen. Wir beschliessen, uns von einigen
Kleidungsstücken zu verabschieden bzw. diese Bedürftigen zu schenken. Die restlichen paar Stunden verbringen wir mit dem Umschichten des Gepäcks. Man bedenke
dabei, dass das gleichzeitig auf dem Benzinkocher mitten auf dem Hotelparkplatz
zubereitete Mittagessen auf etwelche Aufmerksamkeit stösst. Aber irgendwie muss
man ja wieder zu sparen beginnen…
17. Juni 2008
Endlich sitzen wir wieder im Santi und nehmen den langen Weg
in Richtung Heimat unter die Räder. Doch vorerst ist die Heimat in weiter
Ferne. Wir verlassen Pemba auf einer Teerstrasse und begegnen einer schwarzen Frau mit weissem Gesicht. Zum Glück wissen wir, dass sie weder Lepra noch sonst ein Hautproblem hat, sondern ihr Gesicht mit einer weissen Paste "beschmiert" hat. Diese sogenannte "weisse Maske" hat keine kulturelle Bedeutung, sondern wird als
Sonnenschutzmittel und zur Gesichtspflege aufgetragen. Dafür wird das Holz des
Msiro-Baumes gemahlen und das Puder mit Wasser zu einer dicken Paste vermischt. Die Maske wird nur tagsüber getragen und soll die Haut weich halten.

Bei Alua zweigen wir auf eine schmale und ausgewaschene Piste, welche in Richtung Muhula
führt. Mit der Zeit nerven wir uns allerdings etwas, da wir kaum vorankommen und die Strecke landschaftlich nicht besonders viel hergibt. Zudem: Wer wird beim Autofahren schon gerne von Fahrrädern überholt? Stundenlang rumpeln wir in einem
trockenen Bachbett westwärts, bis wir am Abend einen neben einem Teich
gelegenen Schlafplatz finden. Da uns die heutige Fahrt recht ermüdete, klettern
wir bereits kurz nach sechs Uhr auf unsere Matratzen – momentan ist es noch zu
warm, um in die Schlafsäcke zu kriechen.

Nach rund einer Stunde geruhsamen Schlafes werden wir
unsanft geweckt. Gut zwei Dutzend Männer stehen um unseren Santi und fordern
uns auf, sofort auszusteigen. Sie klopfen an die Karosserie und entfachen ein
Feuer. Wir, die wir uns zuerst schlafend stellten, entscheiden uns bald einmal
zur Flucht. Während Helen das Dachzelt herunterklappt, kriecht Markus zum
Fahrersitz. Sowie das Dach geschlossen ist, startet er den Motor und überrascht
die Männer zum ersten Mal. Als er alle Lichter anschaltet, überrascht er sie
zum zweiten Mal. Zudem werden sie durch die starken Lichter (u.a. Xenon) so
stark geblendet, dass sie zum Teil wegspringen. Die 120 dB-Hupe gibt den restlichen
Männern den Rest, und auch sie rennen erschrocken ein paar Schritte zurück. Das
gibt uns den nötigen Platz, um wegzufahren. Dann fliegen grosse Steine, aber
zum Glück sind die Männer zu stark geblendet, um richtig zielen zu können, denn
sie treffen statt der Fenster nur die Sandbleche, eine Seitentüre und das Heck. Mit dem
Heckscheinwerfer blenden wir zudem noch den letzten, der uns hinterher rennt.
Erst nach 16 km stoppen wir, um das Dachzelt besser zu schliessen (bisher war die Zeltplane eingeklemmt), und Helen,
die bis jetzt auf der Matratze lag, kann auf den Beifahrersitz wechseln. Den
ganzen Weg zurück auf die Teerstrasse verlieren wir trotz der abendlichen Kühle
literweise Schweiss, denn die auch bei Tageslicht sehr schwer zu befahrende
Piste nötigt uns alles ab. Zudem haben wir Angst, dass uns ein paar der Männer
verfolgen, und tatsächlich werden wir zweimal von einem Motorrad überholt, aber
glücklicherweise bleiben wir von weiteren Überfallversuchen verschont. Obwohl
wir mit Nachtfahrten mittlerweile schon etwas Erfahrung sammeln konnten,
strengt uns diese Fahrt an wie keine vorher. Zum einen, weil wir gerade erst
vom „Paradies“ zurück in die Wirklichkeit geholt wurden, zum andern, weil die
sehr unebene Piste und die Wasserstellen trotz den Scheinwerfern nur schwer zu
„lesen“ sind. Zudem steht Markus „unter Drogen“, denn er hat am Abend noch Morphium
zu sich genommen, um die wegen der schlechten Piste zurückgekehrten
Rückenschmerzen etwas zu lindern…
Um Mitternacht entdecken wir todmüde einen Schlafplatz
direkt neben der Teerstrasse und können zumindest ein paar Stunden Schlaf
finden.
18. bis 20. Juni 2008
Nach der strapaziösen Nacht geniessen wir ein reichliches Frühstück
und machen uns auf den Weg in Richtung Nampula. Wir lassen uns Zeit für kleine Foto-Stopps und andere Beobachtungen. So stellen wir zum Beispiel vergnügt fest, wie nicht nur wir Touristen, sondern auch einheimische Busgäste von Früchte- und Gemüseverkäufern am Strassenrand belagert werden. Beim Durchqueren eines Flusses fahren wir beinahe mitten durch einen Waschsalon...



Viele Baobabs säumen die hügelige Strecke. Am Nachmittag erreichen wir bei regnerischem und kühlem Wetter das Hotel Executivo, wo wir herzlich begrüsst werden.
Bald sind wir ja Stammgäste in diesem Hotel… Aufgrund der Rückenbeschwerden von
Markus ist es klar, dass wir uns hier einen kurzen Aufenthalt gönnen. Wir
nutzen die Zeit, um uns nach der schlimmen Nacht etwas zu erholen und Helen legt
Markus heisse Massagesteine auf und massiert seinen Rücken mit Massageöl und
einer Massagekugel. Wir sind zuversichtlich, dass die Fahrt bald weitergehen
kann.
Bis es soweit ist, füllen wir unsere Tanks und die Essensvorräte auf, kaufen ein paar Sachen, deren Anschaffung wir schon seit längerem planten, und geniessen das Hotelleben und verzichten dankend auf das Dessert nach dem Abendessen (vielleicht hat der Koch ein weiteres Mal Salz und Zucker verwechselt...). Leider erweist sich das Wechseln unseres sambischen Geldes in Nampula als unmöglich - nicht einmal die Nationalbank erklärt sich als hiezu zuständig.
21. Juni
2008
Auch wenn
wir froh sind, Nampula verlassen zu können, fällt uns der Abschied doch etwas
schwer, schliesslich kennen wir langsam fast die gesamte Belegschaft (inkl. Hotelmanager) vom Hotel, und der Abschied fällt entsprechend herzlich aus.



Bald aber fahren wir in westlicher Richtung durch eine wunderschöne Landschaft. Blanke Granitberge, die
aussehen, als seien sie mit einer Zahnbürste von Bäumen, Gras und Erde befreit
worden, wechseln sich ab mit weiten Ebenen sowie Wald- und Buschlandschaften.
Einsam ist die Strecke aber nicht, denn kaum verlässt man ein Dorf, befindet
sich man bereits in der nächsten Siedlung. Nach
unserer negativen Erfahrung betreffend Campieren zwischen moçambikanischen
Dörfern kommen wir zum Schluss, bis nach Cuamba zu fahren und dort nach einer geeigneten Übernachtungsgelegenheit zu suchen. Moçambique ist unter anderem nicht nur sehr reich an Bananenplantagen, sondern auch an Papayabäumen.





Unterwegs queren wir mehrmals ein Geleis, das aussieht, als ob seit Urzeiten kein Zug mehr darüber fahren
würde. Trotzdem entdecken wir mit einem Male einen Zug, der von einer
Menschentraube belagert wird. Offenbar handelt es sich um eine Bahnstation, und
Bauern versuchen, ihre Ernte den Bahnreisenden zu verkaufen. Wir sind etwa
gleich schnell (oder langsam) unterwegs wie die Eisenbahn, uns so winken wir
den Reisenden mehrmals zu, was diese zum Teil mit fröhlichem Winken und Johlen
quittieren.


Cuamba
erreichen wir erst in der Dunkelheit, und der uns von einer Pension offerierte
Schlafplatz in einem Hinterhof erscheint uns für den Fall einer Flucht nicht
gerade ideal. Schliesslich landen wir bei einer indischen Familie, die uns zu
ihrem von einem Wächter bewachten Ladenlokal führt und meint, dort können wir
beruhigt (und bewacht) schlafen. Der Wächter hat Freude, einmal etwas anderes
bewachen zu können, und wir haben das einmalige Erlebnis, mitten in einer Stadt
an einem Strassenrand zu schlafen.
Noch ein paar persönliche Worte zu Moçambique: Moçambique gilt als das fünftärmste Land der Welt, und die verschiedensten Hilfswerke geben sich hier die Klinke in die Hand. Die Hilfswerke aufzuzählen, ist sinnlos - mehr Sinn machen würde es, jene zu nennen, die nicht in Moçambique aktiv sind. Wir besuchten in Moçambique die verschiedensten Regionen. Wir waren nicht nur in Grossstädten, sondern auch bei ganz kleinen, abgelegenen Häusergruppen. Auch hatten wir ein wenig ein mulmiges Gefühl bei der Einreise, weil wir unzählige Hungerbäuche erwarteten. Das Bild, welches sich uns präsentierte, war jedoch diametral anders: Überall, sogar in den höchstgelegenen Dörfchen in den abgelegensten Bergregionen trafen wir Kleiderverkäufer an. Diese Verkäufer hatten nicht nur ein paar wenige Socken im Sortiment, sondern mehr, als viele Kleiderläden in Europa im Sortiment führen. Von T-Shirts in allen Farben und Grössen zu den verschiedensten Bluejeans, Jacken, Pullovern und Tüchern gab es alles zu kaufen, was das Herz begehrt. Sogar Unterwäsche und BHs waren in den Auslagen. Zudem waren sämtliche Menschen (und zwar wirklich ausnahmslos alle) wohlgenährt. Zwar trafen wir wenig wirklich dicke Personen an, aber sogenannt Vollschlanke liefen uns nicht gerade selten über den Weg. Wir fragten uns, was hier nicht stimmt. Bald wurde uns klar, dass die Kleider zum allergrössten Teil aus Hilfslieferungen von Europa stammen. Wir sahen mehrere riesige mit Kleiderballen beladenen Lkws, und in Cuamba beobachteten wir, wie eine sehr grosse Lagerhalle bis zum Dach hin mit Kleiderballen gefüllt war. Offenbar werden noch immer Kleider gesammelt und nach Moçambique geschickt, obwohl dort ein Überfluss an Kleidern herrscht. Doch wohl aufgrund der Korruption werden die Kleider nicht gleichmässig unter der Bevölkerung verteilt. Die Kleiderverkäufer ersticken beinahe in ihren Kleidervorräten, und ein paar arme Menschen laufen trotzdem noch in zerfetzten Kleidern umher. Das mit der Nahrungshilfe muss ähnlich verlaufen. Zu Beginn unserer Reise zählten wir die Nahrungsmittelsäcke am Strassenrand. Doch bereits nach drei Tagen hörten wir auf, weil wir mit dem Zählen nicht mehr nachkamen. Wir sahen Tausende und Abertausende von Tonnen von Nahrungsmittelsäcken, die überall - zum Teil am Strassenrand, zum Teil in Dörfern, zum Teil vor Hütten, und zum Teil in riesigen Lagerhallen - herumlagen. Uns ist bewusst, dass in Moçambique durch den Bürgerkrieg, durch die Zahlungsunfähigkeit der Regierung und durch die Hungersnot vor ein paar Jahren grosse Probleme hatte. Doch sind diese Probleme im Bereich der Bekleidung und der Nahrung längst überwunden. Aufgrund des fruchtbaren Bodens, der riesigen Plantagen und der beinahe unendlich grossen, zum Ackerbau geeigneten Flächen wäre die Bevölkerung sehr wohl in der Lage, sich selbst zu ernähren. Aber solange das Land nicht nur bezüglich Kleider, sondern auch betreffend der Nahrungsmittel die Unterstützung der Weissen erhält, verharren die Moçambiquaner in ihrer Lethargie. Wenn auch nur ein Bruchteil der Leute, die den ganzen Tag in den Dörfern herumhängen, Ackerbau oder Viehzucht betreiben würden, wären sie bald nicht mehr auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Obwohl es Sambia gemäss WHO besser gehen sollte, haben wir in Sambia bedeutend grössere Not gesehen. Trotz dieses Umstandes haben wir nie einen bettelnden Sambier getroffen. In Moçambique dagegen war es das pure Gegenteil. Sehr oft wurden wir von gut genährten Menschen angebettelt, ihnen etwas zu essen zu geben. Vielleicht wäre ein Umdenken der ausländischen Regierungen, Hilfsorganisationen und Touristen angesagt!




22. Juni
2008
Nach einer
etwas nicht besonders ruhigen Nacht brechen wir frühmorgens auf in Richtung
Grenze (Chiponde), wo wir um die Mittagszeit eintreffen. In nur gerade einer
Stunde sind wir aus Moçambique aus- ...
vorheriges Land: Sambia Zurück zur Tagebuch-Übersicht nächstes Land: Malawi